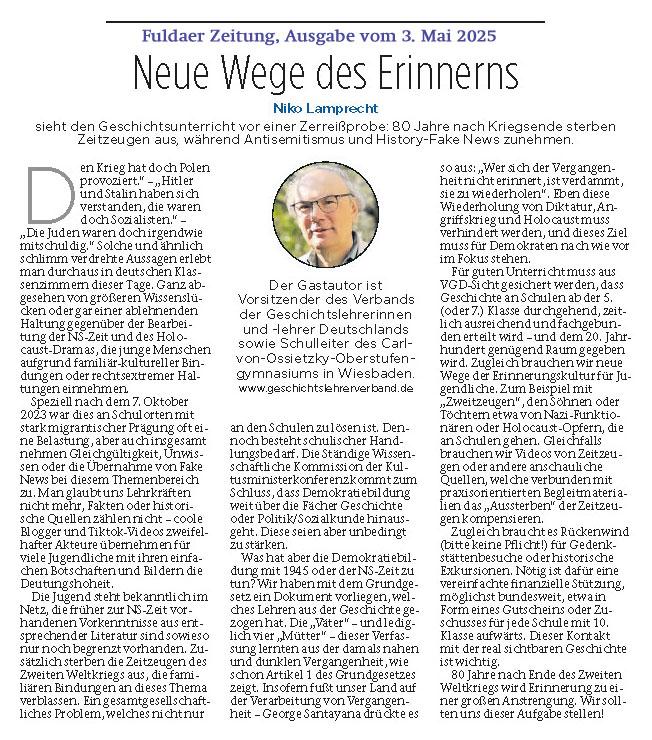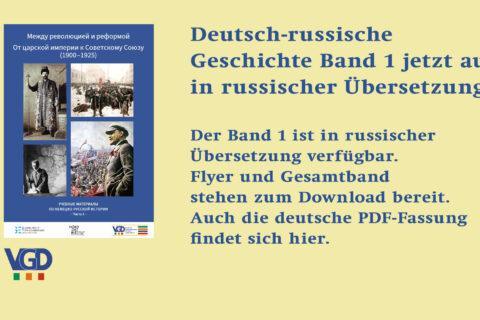8.Mai 1945 – 80 Jahre danach
Gemeinsame Stellungnahme von VGD und VHD
Der 80. Jahrestag der Befreiung Deutschlands und Europas vom Nationalsozialismus ist untrennbar verbunden mit der kritischen Erinnerung an die Kapitulation des Deutschen Reiches und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die Zeitzeugen sterben, die kollektive Erinnerung verblasst, der Antisemitismus nimmt zu. Relativierung, Verharmlosung und Leugnung von NS-Verbrechen halten dieser Tage immer öfter Einzug in deutsche Klassenzimmer.
Die Vorsitzenden des deutschen Verbands der Geschichtslehrerinnen und -lehrer (VGD) und des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands (VHD) sehen dringenden Handlungsbedarf, um auch in der Zukunft das Wissen um diese Voraussetzungen unserer Demokratie in unserer Gesellschaft lebendig zu erhalten.
„Den Krieg hat doch Polen provoziert.“ – „Hitler und Stalin haben sich verstanden, die waren doch Sozialisten.“ – „Die Juden waren doch irgendwie mitschuldig.“ Solche und ähnliche Falschaussagen hört man in deutschen Klassenzimmern dieser Tage. Sie werden bedrohlich angesichts immer größerer Wissenslücken oder einer wachsenden Ablehnung junger Menschen, wenn es um die Bearbeitung der NS-Zeit und des Holocausts geht. Oft spielen dabei familiär-kulturelle Bindungen oder rechte Haltungen eine Rolle. Dazu ertönt auch politisch der Ruf, „es jetzt einmal gut sein zu lassen“ mit der NS-Zeit.
Leugnung oder Verharmlosung des Judenmords und Antisemitismus haben nach dem
7. Oktober 2023 nicht nur an Schulorten mit stark migrantischer Prägung Gehör und Zustimmung gefunden. Gleichgültigkeit, Unwissen sowie Fake News bei diesem Themenbereich sind der ideale Nährboden. Man glaubt Lehrkräften nicht mehr, historische Fakten oder mühsam zu erarbeitende Quellen zählen nicht – Blogger, Videos diverser zweifel- oder unzweifelhaft rechter Akteure übernehmen für viele Jugendliche mit ihren einfachen Botschaften und Bildern die Deutungshoheit.
Demokratiebildung in Deutschland kommt nicht ohne Kenntnis der NS-Zeit, des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen aus. Wir haben mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik ein Dokument vorliegen, in dem schon mit Artikel 1 die „Väter“ und „Mütter“ der Verfassung deutlich gemacht haben, dass sie Lehren aus der damals nahen und dunklen Vergangenheit ziehen wollten. Unsere Demokratie fußt auf der Verarbeitung dieser Vergangenheit und der Übernahme historischer Verantwortung. Die Wiederkehr von Diktatur, Angriffskrieg und Holocaust sollten 1949 verhindert werden. Und dieses Ziel ist auch heute noch aktuell.
Unsere Demokratie steht heute, 80 Jahre danach, wieder vor der Herausforderung, wie Geschichtskultur und kollektive Erinnerung dieser Aufgabe gerecht werden. Das betrifft nicht nur unsere Hochschulen und Schulen – und ist sicherlich nicht allein dort zu lösen. Aber gerade an Schulen besteht dringender Handlungsbedarf. Das hat auch die Kultusministerkonferenz erkannt. Deren Ständige Wissenschaftliche Kommission hat 2024 die Empfehlung formuliert, dass Demokratiebildung weit über die Fächer Geschichte oder Politik/Sozialkunde hinausgehen müsse. Zudem seien auch diese Fächer unbedingt zu stärken – und nicht gegeneinander ausspielbar.
Was schlagen VHD und VGD e.V. konkret vor?
Guten Unterricht: Wir müssen sicherstellen, dass Geschichte an Schulen ab 5. (oder 7.) Klasse durchgehend, zeitlich ausreichend und fachgebunden (nicht als „Verbundfach“) erteilt wird. Die Qualität des Unterrichts beginnt mit der angemessenen Fachausbildung der Lehrkräfte: es geht zentral darum, kritische Urteilsbildung und Bewertungskompetenz im Umgang mit Behauptungen über Schlüsselereignisse unserer Geschichte zu vermitteln.
Neue Wege: Wir brauchen neue Wege der Erinnerungskultur für Jugendliche. Die letzten Zeitzeugen sterben und wir sind gezwungen Alternativen zu entwickeln: Zum Beispiel mit sogenannten Zweitzeugen, den Nachkommen etwa von Nazi-Funktionen oder Holocaust- Opfern, die an Schulen gehen und deren Besuche staatlich gefördert werden. Gleichfalls brauchen wir digitale Zeugnisse von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen oder andere anschauliche Dokumentationen der kritischen Ereignisse, die mit Unterrichtsmaterial unterfüttert werden.
Erinnerungsorte aufwerten: Wir brauchen endlich Rückenwind – aber keine Pflicht – für Gedenkstättenbesuche oder historische Exkursionen. Wir appellieren an die neue Bundesregierung mit ihrem Koalitionsvertrag Ernst zu machen und durch konkrete Angebote und Maßnahmen, wie vereinbart, solche Besuche verstärkt zu ermöglichen. Die vielen Hindernisse für Genehmigungen und Organisation müssen beseitigt, eine einfachere finanzielle Unterstützung (Gutscheinsystem) organisiert werden. Dies würde die Besuche und den Kontakt mit der real sichtbaren Geschichte erleichtern.
Handlungssicherheit und Sprechfähigkeit gegenüber populistischen und rechtsextremen Äußerungen stärken: Sowohl in der Gesellschaft als auch an Hochschulen und Schulen werden wir immer häufiger mit „Stammtischparolen“ und tendenziösen Äußerungen konfrontiert. Dem sehen sich insbesondere auch Lehrkräfte in Bildungseinrichtungen ausgesetzt. Um adäquat reagieren und argumentativ begegnen zu können, sind gezielte Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen notwendig, aber auch eine klare Rückendeckung im Konfliktfall.
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Europas und Deutschlands vom Faschismus wird Erinnerung zu einer großen Anstrengung. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen!
Niko Lamprecht
Vorsitzender des VGD
Prof. Dr. Lutz Raphael
Vorsitzender des VHD
Gastkommentar in der Fuldaer Zeitung